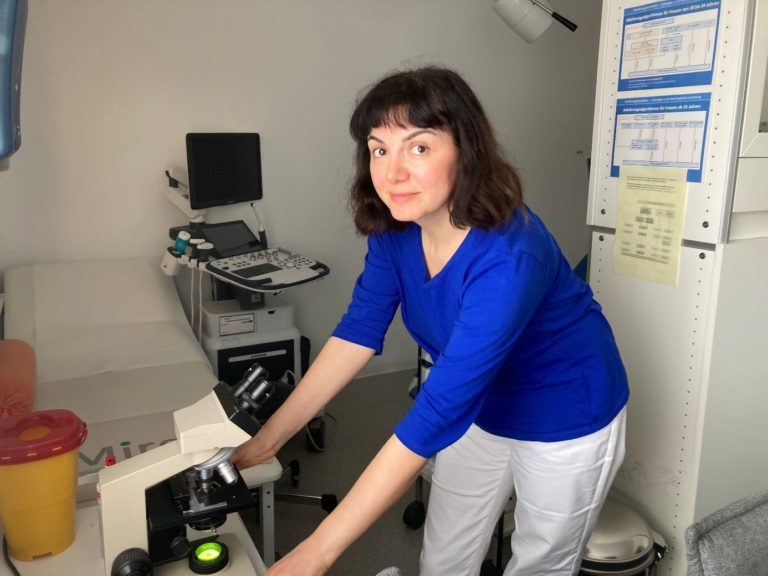Seit zwei Jahren lebe ich in Paris, direkt an einer großen Straße, dem Boulevard Diderot im Osten der Stadt. Ein riesen Lärm: das Hintergrundrauschen der Autos, das ich irgendwann vergesse, die gelegentlichen Krankenwagen- und Feuerwehrsirenen, die Motorräder und hupenden Taxis, die mich dann wieder an die große Straße vor meiner Haustür erinnern. Am Anfang kann ich nur schwer einschlafen und schrecke nachts vom Straßenlärm auf. Jeden Morgen gehe ich die Straße runter Richtung Zentrum. Jeden Morgen sehe ich dort eine Frau in ihren Vierzigern in einem großen Pelzmantel vor ihrem Zelt sitzen. Ich frage mich, wie sie diesen Lärm nur aushält. Meistens hält sie eine Zigarette in der Hand, manchmal spricht sie mit Passant:innen oder füttert Tauben. An anderen Tagen beobachtet sie lächelnd das rege Treiben oder malt. Um ihr Zelt, große bunte Leinwände mit politischen Botschaften. Auf einem kleinen Tisch liegen Pinsel, Farben und Bücher. Sie muss Künstlerin sein, denke ich.
Als ich eines Tages mit Samira ins Gespräch komme, ärgere ich mich über mich selbst. Ich merke, dass ich in meinem Kopf ein lebensfernes Bild von ihr gezeichnet hatte. Eine obdachlose Pariser Künstlerin im Pelzmantel, wie interessant, dachte ich. Wie naiv von mir, denn die Realität der Straße lässt sich nicht romantisieren. Am Anfang bin ich verblüfft von dem, was sie mir erzählt, und frage weiter, versuche zu verstehen. Irgendwann weiß ich nicht mehr, was ich noch glauben kann und was nicht.
Samira erzählt mir mit verrauchter Stimme, sie sei früher Geheimagentin gewesen und habe in einer nuklearen Hochsicherheitszone gelebt und gearbeitet. Sie nennt mir die Postleitzahl: eine kleine Gemeinde östlich von Paris. Nach einem terroristischen Anschlag auf ihr Eigentum habe sie schließlich fliehen müssen. Seit sechs Jahren lebe sie deshalb auf der Straße, hier auf dem Boulevard Diderot. Ihre beiden Kinder Anin und Shahin seien angesehene Doktoren und mehrfache Bestsellerautor:innen. Sie nennt mir mehrere Buchtitel, zum Beispiel „La rose dans les ténèbres“. Zuhause recherchiere ich und finde nur den gleichnamigen Roman der britischen Schriftstellerin Christianna Brand aus dem Jahr 1979. „Die Polizei hat mich beschuldigt, Teil einer terroristischen Sekte zu sein. Meine Kinder haben alle unsere Dokumente und Habseligkeiten verbrannt, damit wir keine Spuren hinterlassen“, erzählt Samira. Sie warte darauf, dass Anin und Shahin „ihre Mission“ abschließen, woraufhin sie mit ihnen untertauchen wolle. Samira ist sich sicher, verfolgt und überwacht zu werden, auch weil sie Jesuitin sei. Der ehemalige französische Justizminister Éric Dupond-Moretti habe das sogar im Fernsehen verkündet: „Er hat klar gesagt, dass man mich rund um die Uhr verfolgt, auf allen Kanälen. Die allerhöchste Staatsgewalt überwacht mich! Auch Journalisten!“, erklärt mir Samira. Die Polizei habe ihr geraten, sich zu bewaffnen, auch weil sie viele sexuelle Übergriffe habe erleben müssen.
Als ich sie nach ihrer Kunst frage, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. „Früher habe ich wenig gemalt“, erinnert sich Samira, „jetzt versuche ich, mich durch meine Bilder auszudrücken. Und die Menschen zu warnen“. „Wovor?“, frage ich sie. „Wir befinden uns mitten in einem Währungszusammenbruch. Wir sitzen einer riesigen Betrugsfalle auf. Schuld sind die Vereinten Nationen!“. Auch hinter der fehlenden Weihnachtsdeko auf dem Boulevard Diderot vermutet sie eine Verschwörung. Denn alle Seitenstraßen seien in der Weihnachtszeit dekoriert, nur die ihre nicht.
Freund:innen oder Familie habe Samira keine: „Sonst wäre ich nicht hier. Ich kenne niemanden außer Passanten“. Sie fühle sich deshalb oft einsam, erzählt sie. Am Boulevard Diderot hat sich Samira ihren Platz erkämpft. Anders als viele andere Obdachlose wird sie nicht vertrieben. In Paris ist das ungewöhnlich, denn meist werden Menschen ohne festen Wohnsitz schnell aus dem Stadtbild verdrängt, vor allem seit den Olympischen Spielen im letzten Jahr. „Es gibt Beschwerden, dass ich zu viel Platz einnehme. Aber wo soll ich denn sonst hin?“, fragt sie.
Samiras Geschichte ist außergewöhnlich – ein Schicksal von vielen, das das Leben auf der Straße schreibt. Aber ihre Erzählungen machen deutlich, was ein Alltag ohne festen Schutzraum bedeutet: eine Last für Körper und Geist, die nur durch Realitätsflucht erträglich wird.
Text: Nasrine Mouti, Jana Renkert
Fotos: Jana Renkert