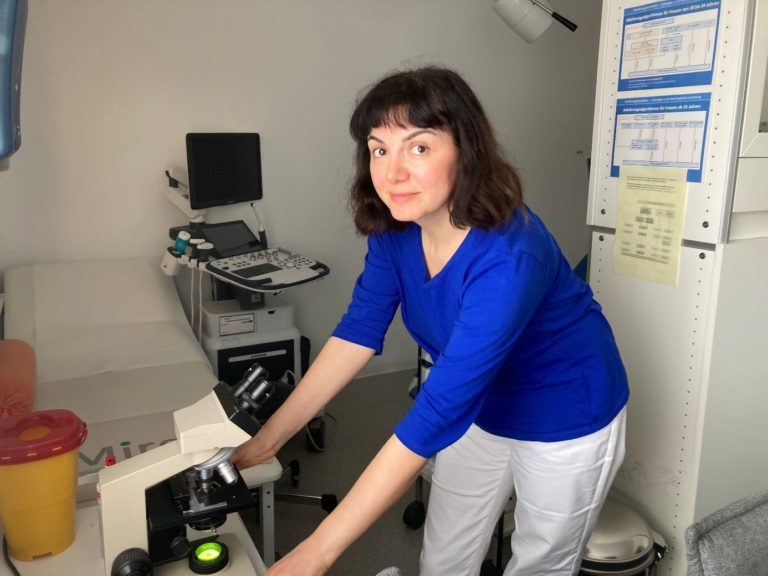Es ist der letzte heiße Sommertag des Jahres. Schon um zehn Uhr morgens brütet die Sonne auf dem Alexanderplatz. Dort steht Janet Amon im grünen Kleid mit großem Sonnenhut. Um sie bildet sich eine kleine Gruppe, bunt durchmischt, von jung bis alt.
„Noch ein bisschen müde?“
– „Ja, und nervös. Bei den Touren kommen fremde Leute, da weiß ich nie so ganz, was mich erwartet. Und ehrlich gesagt, auch noch nicht die beste Laune“.
„Du weißt, dass dein Mikrofon noch an ist, Janet?“
– „Jaja, aber das dürfen ruhig alle hören“.
Janet nimmt kein Blatt vor den Mund. Die schlechte Laune lässt sie sich zwar nicht anmerken, sie verheimlicht sie aber auch nicht. Und mit dieser Ehrlichkeit geht es los. Janet nimmt uns mit in ihre Vergangenheit. Die gelernte Schauwerbegestalterin und gebürtige Hamburgerin war in mehreren Städten obdachlos, unter anderem in Berlin, Hamburg, Lüneburg, München und Bonn. Janet wurde Opfer häuslicher Gewalt durch ihren Ex-Partner und landete auf der Straße. Geld hatte sie nie, vor allem wegen ihrer Drogensucht. Durch Zufall kam Janet zu Beginn der Corona-Pandemie dann nach Berlin. Sie hatte nur ein paar alte Freunde besuchen wollen und deshalb den nächsten Bus nach Berlin gebucht. So ist sie mit dem letzten Rest Geld, den sie noch hatte, neunzig Euro, in der Hauptstadt angekommen.
Das Leben „auf der Platte“
Zweite Station der Tour: ein unscheinbares Hochhaus in der Alexanderstraße, beige-geflieste Fassade. Hier hat sich Janet in ihrem Schlafsack auf die Treppe vor dem Hauseingang gelegt. Als sie am nächsten Morgen aufgewacht ist, war ihr Schlafsack aufgeschnitten, ihr Handy und die letzten neunzig Euro weg.
Es geht weiter, sie führt uns zur nächsten Station. „Wir laufen jetzt so, wie ich damals gelaufen bin“, sagt Janet. Panisch sei sie zur Polizeiwache am Alex gegangen und habe Anzeige erstatten wollen. Erst später habe sie erfahren, dass diese Anzeige nie im System aufgenommen wurde. Von da an hat sie zusammen mit anderen Obdachlosen „auf ihrer Platte“ unter der S-Bahn-Brücke am Stromkasten gelebt. Dort habe sie sich sicher gefühlt. In manchen Nächten musste Janet um ihren Schlafplatz kämpfen, auch mit Fäusten. Aber ihre Gruppe gab ihr Schutz: „Mit den anderen konnte ich wieder Frau sein und das ganze Männergehabe lassen“, erzählt sie, „davor war ich oft aggressiv, damit ich nicht wie ein leichtes Opfer wirke“. Endlich habe sie keine Angst mehr haben müssen.
Obdachlose müssen gehen: oh, besinnliche Weihnachtszeit
„Wir hatten einen Becher, mit dem wir geschnorrt haben. Wenn ich Nachtwache hatte, habe ich da mit den Münzen reingeworfen und versucht, den Becher zu treffen. Irgendwann war ich mit links besser als mit rechts“, erinnert sich Janet schmunzelnd. Vom Schnorrgeld habe man sich das gekauft, was gerade gebraucht wurde. Vor allem Tabak oder Alkohol, „manchmal auch ein Schlüppi oder Socken“, sagt Janet.
„Wie verdient man auf der Straße sonst noch Geld?“, fragt sie uns. Pfandflaschen sammeln, Straßenzeitung verkaufen, Klauen, Dealen, Straßenmusik, Anschaffen. Sieben Jahre lang sei Janet Anschaffen gegangen, um sich ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Vor allem als Frau käme man außerdem oft in die Position, für einen Schlafplatz sexuelle Dienstleistungen erbringen zu müssen. „In so einer ekligen Position war ich auch schon“. Janet hat aber auch andere Erfahrungen gemacht: Sie habe eine alte Dame kennengelernt, der sie schließlich im Haushalt half. Janet habe sie gebadet oder für sie eingekauft. Wenn Janet ein paar Wochen nicht zu ihr kam, habe sich in dieser Zeit auch niemand um die Seniorin gekümmert. „Wir haben eine tolle Beziehung aufgebaut und uns gegenseitig geholfen“, berichtet Janet.
In ihrer Zeit in Bonn habe Janet außerdem Straßenzeitung verkauft. Dadurch kam Janet in Kontakt mit Passant*innen. „Das waren wertvolle Beziehungen, Ansprechpersonen, die gefragt haben, wie es mir geht und die sich wirklich für mich interessiert haben“. Das war leider nicht immer so: Oft wurde Janet angepöbelt oder vertrieben. Im Winter musste sie am Alexanderplatz ihre Sachen zusammenpacken, denn „in der Weihnachtszeit wird heile Welt gespielt“, erzählt sie. Da habe Obdachlosigkeit keinen Platz.
„Straße macht krank“
Janet kenne kaum jemanden auf der Straße ohne Sucht, sagt sie: „Straße macht krank“. Die psychische Belastung sei enorm, die ständige Angst vor Vergewaltigung und Schlägereien habe sie zu immer mehr Konsum getrieben. „Nur wenn ich betrunken oder drauf war, konnte ich das alles locker sehen und ertragen“. Janet ist polytoxikoman, das heißt ihre Abhängigkeitserkrankung betrifft mehrere Substanzen gleichzeitig. Neben Kokain, Speed, Ecstasy, LSD und Alkohol habe sie auch zwanzig Jahre lang Heroin konsumiert. Heute ist sie im sechsten Jahr heroinfrei. Doch für Janet sei Alkohol die schlimmste Droge, von der sie auch heute noch nicht loskomme. „Das Zeug ist überall legal zu kaufen. Ich sehe Alkohol in jedem Supermarkt. Das macht es nicht leicht“, gesteht sie. „Angefangen habe ich mit vierzehn Jahren nach dem Tod meines Adoptivvaters. Denn Trinken war zuhause okay“.
Am Zoo wurde Janet Opfer eines gewalttätigen Übergriffs durch ihren Ex-Partner. „Er hat mir mit einer Dachlatte eins übergezogen. Ich hatte kein Handy. Und dann ist ein Bundespolizist vorbeigekommen und ich habe ihm gesagt, dass ich Hilfe brauche“. Doch der habe ihr nur die Arme auf den Rücken gedreht und sie zu Boden gedrückt. „Für dich hol ich keinen Krankenwagen“, habe der Polizist geantwortet. Tagelang sei Janet in ihrem Zelt gelegen, mit offenen Wunden und Fieber. Durch Glück hätten Sozialarbeiter*innen sie ins Krankenhaus gebracht, sonst wäre sie dort gestorben, sagt Janet. „Die Gewalt gegen Obdachlose nimmt zu“, ist sich Janet sicher. Sie kenne jemanden, der in seinem Schlafsack zugeschnürt und ins Wasser geworfen wurde. Eine Bekannte von ihr wurde im Schlaf angezündet.
Politik für die Straße
Heute wohnt Janet in einem besetzten Haus in der Habersaathstraße. Ihre Zeit auf der Straße habe sie politisiert. Deshalb kämpft sie jetzt für die Rechte von obdachlosen Menschen. Janet bricht mit dem Tabu Straße, zum Beispiel bei den Stadtführungen von querstadtein e.V. und einer Vielzahl anderer Projekte. Janet spricht über defensive Architektur, über Hygiene auf der Straße. Wie gehen Obdachlose wählen? Was ist die meistgenutzte App auf der Straße?
„Diese Arbeit gibt den Betroffenen eine Aufgabe, für die es sich lohnt, morgens aufzustehen. Sie haben wieder einen Sinn im Leben“, sagt Clemens Poldrack von querstadtein e.V., der die Tour begleitet. Guides wie Janet können sich durch die Führungen etwas dazuverdienen. Diese Arbeit sei nicht selten emotional, erzählt Clemens. Die meisten Guides würden deshalb nur ein paar Führungen pro Woche geben. Denn Janet und ihre Kolleg*innen teilen sehr persönliche, teilweise traumatische Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit.
Doch ihre Arbeit hat Erfolg. Unter den Teilnehmenden ist auch die Studentin Merle. Sie wolle ihre Berührungsängste mit Obdachlosen überwinden – in der Bahn nicht mehr nur auf das Handy starren, wenn jemand nach Geld fragt. „Als Kind hat man Erfahrungen gesammelt, wo man vielleicht Angst hatte“, erzählt sie, „aber heute glaube ich, dass diese Angst oft unbegründet war“.
Nach über zwei Stunden endet Janets Stadtspaziergang an der Humboldt-Promenade. Doch zum Abschied gibt es schlechte Nachrichten, die die kleine Gruppe nachdenklich zurücklassen. In der Habersaathstraße liegt eine neue Abrissgenehmigung auf dem Tisch. Janet und die anderen Besetzer*innen müssen das Haus vermutlich bald räumen. Wie es dann weitergeht, weiß sie noch nicht.
Weitere Informationen zu den Stadtführungen von querstadtein e.V.:
Hast du Interesse an einer Tour von Janet oder anderen Menschen zu den Themen „Wohnungslosigkeit & Leben auf der Straße“ teilzunehmen? Tickets bekommst du auf www.querstadtein.org.
Termine für Gruppen können nach individueller Absprache vereinbart werden. Einzeltickets können in der Regel für Führungen am Wochenende gebucht werden. Tickets kosten ermäßigt 13 Euro, normal 17 Euro und zum Unterstützerpreis 20 oder 30 Euro.
Querstadtein e.V. bietet außerdem Führungen zu den Themen „Berliner Migrationsgeschichten“ und „Klima-Migration“ an, bei denen Menschen mit eigener Flucht oder Migrationserfahrung berichten.
Fotos: Megan Auer
Text: Jana Renkert